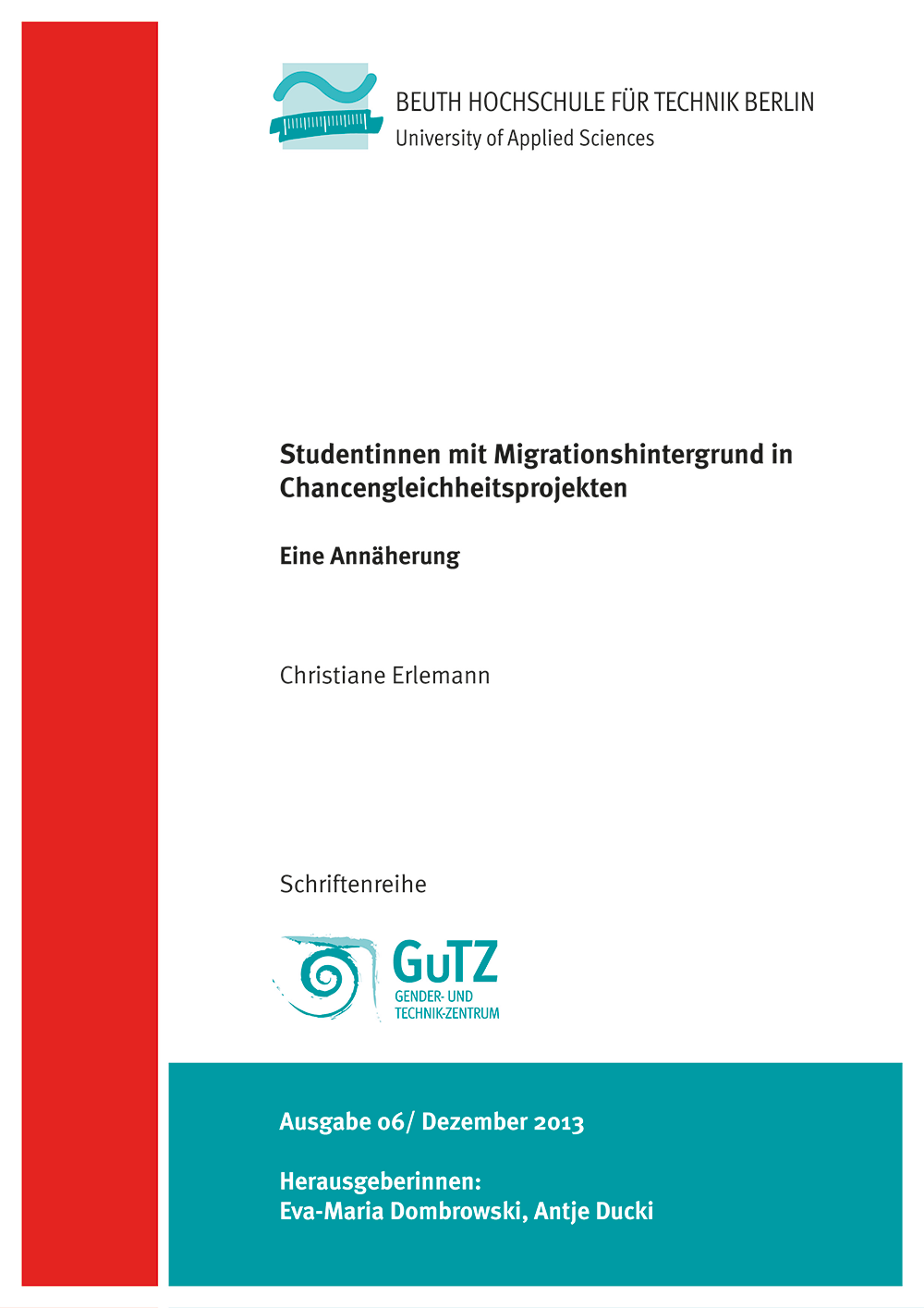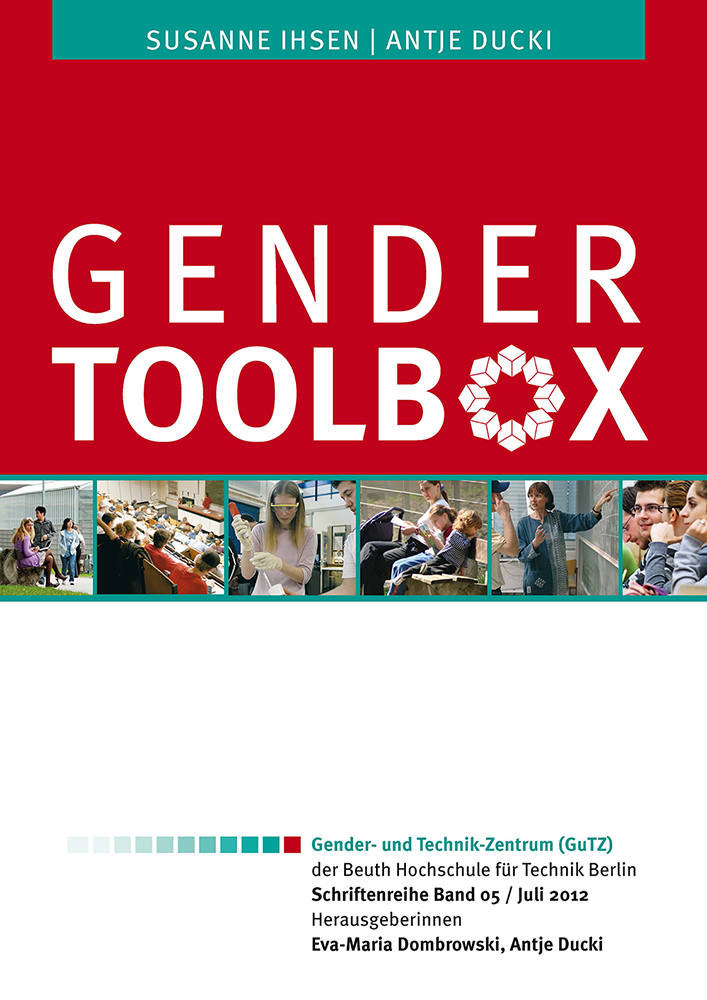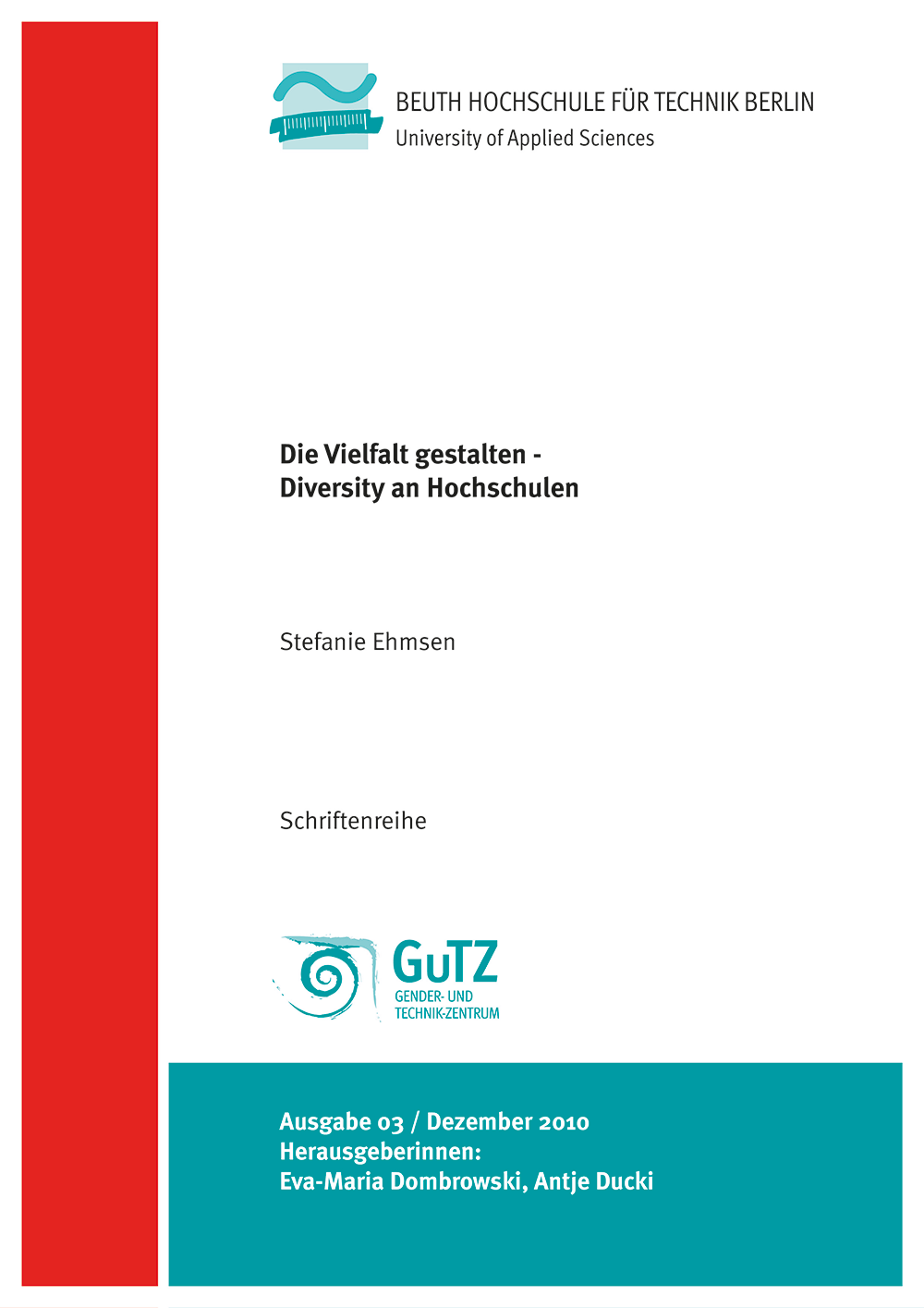Publikationen
Longreads
von Anja Goetz & Silvia Arlt
Es gibt soziale Phänomene für die im Deutschen englische Varianten, sogenannte Anglizismen, genutzt werden. Das hat den Vorteil, dass keine neuen Wörter für existierende Dinge gefunden werden müssen. Teilweise gestaltet sich das auch schwierig, wie die Überschrift zeigt. Mit keiner der drei Übersetzungen könnte irgendjemand etwas anfangen. Im Englischen handelt es sich hierbei um Downblousing, Upskirting und Stealthing. Nachteilig ist, dass die Übernahme von Wörtern aus dem Englischen einer gewissen Gruppe von Menschen vorbehalten bleibt, obwohl es sich um gesamtgesellschaftlich relevante Ungerechtigkeiten handelt. Alle drei Situationen kommen im Alltag gehäuft vor, so dass eine Beschreibung – also ein Wort – gefunden werden muss. Denn solange für Phänomene keine Wörter existieren, sind sie quasi nicht vorhanden. Sie erhalten ihre Relevanz erst mit einer Form von Versprachlichung. Kurzum: Was wir nicht beschreiben können, gibt es nicht.
Downblousing und Upskirting beschreiben das unerlaubte, oft heimliche Fotografieren in den Ausschnitt oder unter den Rock einer Person. Da hier überdurchschnittlich oft Frauen zum Opfer gemacht werden, handelt es sich um ein geschlechtsspezifisches Phänomen. Stealthing ist das unerlaubte Abstreifen des Kondoms während des Geschlechtsverkehrs. Genau wie Downblousing und Upskirting ist dies seit kurzem eine Straftat in Deutschland. Während im Alltag oder vor Gericht zumeist Einzeltaten verhandelt werden, lässt sich am Beispiel des Stealthing eine gesellschaftliche Einordnung und damit deren Relevanz sehr gut zeigen:
Der Gewaltakt hinter dem Abstreifen eines Kondoms ist nicht nur mit der Gefahr der Übertragung von Krankheiten oder des Schwangerwerdens gegeben. Ein Mann entscheidet, dass der*die Partner*in kein Recht darauf hat, mitzuentscheiden oder eine eigene Entscheidung zu treffen. Seine Entscheidungsfreiheit wird über die einer anderen Person gestellt. Diese Form von Anspruchshaltung basiert auf einem Weltbild, dass sagt, du hast das Recht dich über den Willen anderer hinwegzusetzen, weil deine Meinung mehr wert ist. Auch Frauen haben diese Haltungen verinnerlicht, wenn sie lernen, dass es ok ist, wenn sich Männer in kleinsten Alltagssituationen über ihren Willen hinwegsetzen. Sei es das ungewollte Hinterherpfeifen im öffentlichen Raum (übrigens auch ein englischer Begriff: Catcalling) oder das breitbeinige Sitzen (englisch: Manspreading), während die weibliche Person mit überschlagenen Beinen versucht den restlichen Platz in der S-Bahn zu beanspruchen. Früher war es der „dumme-Jungen-Streich“, bei dem sich Jungs einen kleinen Spiegel an die Sandale gebastelt haben, um einen Blick unter den Rock der Mitschülerin werfen zu können. But so what, boys will be boys – oder? Doch was aus verinnerlichten Anspruchshaltungen werden kann, zeigt die strafrechtliche Einordnung des Stealthing. Mit der Digitalisierung bekommen diese Formen geschlechtsspezifischer Gewalt nochmal eine andere Dimension. Bilder und Videos können heute schneller mit einer Vielzahl von Personen geteilt werden, so dass der Kontrollverlust des Opfers um ein Vielfaches erhöht wird.
Es stellt sich die Frage, ob die fehlende oder schwierige Übersetzung darauf hindeutet, dass die beschriebenen Gewalttaten eben nicht gesamtgesellschaftlich relevant sind oder dass wir immer einige Meter hinter den aktuellen Debatten zurück sind.
von Kaja Napotnik
Du meinst, der 1,0-Schulabschluss ist kein Zeichen deines Intellekts. Ganz ehrlich, der eine Prüfer hatte zum Schluss doch sichtlich Mitleid. In deinem Praktikumszeugnis stehen Wörter wie „schnelle Auffassungsgabe“ und „zu unserer äußersten Zufriedenheit“, aber alle wissen doch mittlerweile, dass Praktikumszeugnisse eine reine Floskel-Sammlung darstellen. Und dass dich die Betreuerin deiner Masterarbeit für eine Promotionsstelle in Betracht zieht, ist lediglich ein Beweis ihrer fachlichen Inkompetenz.
So manche werden in diesen Sätzen ihre inneren selbstabwertenden Monologe wiedererkennen. Doch nur wenigen war bislang bewusst, dass es sich um ein psychologisches Phänomen handelt, das überraschend viele Menschen betrifft. Das sogenannte Impostor-Phänomen (Impostor = Betrüger*in) wurde 1978 definiert als die anhaltende Überzeugung einer Person, sie sei – trotz gegenteiliger Beweise – inkompetent, hätte sich ihren Erfolg nicht wirklich verdient und würde anderen ihre intellektuellen Fähigkeiten nur vortäuschen. Betroffene Personen betrachten es als eine Frage der Zeit, bis sie von anderen „erwischt“ werden. Dieser Zustand wird nicht selten von Angstzuständen, Stress, schädlichen Arbeitsgewohnheiten und Depressionen begleitet. Anfangs wurde davon ausgegangen, dass vor allem erfolgreiche Frauen (in der Wissenschaft) davon betroffen seien. Neuere Forschungen zeigen hingegen, dass es sich um ein geschlechterübergreifendes Phänomen handelt. Sogar die Hälfte aller erfolgreichen Menschen (und das nicht nur geschlechts-, sondern auch alters- und berufsunabhängig) berichten, dass sie solche Gefühle mehr oder weniger oft erleben.
Wer liegt falsch, die Betroffenen oder doch das Konzept?
Die Annahme ist also, dass Betroffene nicht in der Lage sind, objektiv zu bewerten, wie gut ihre Leistungen tatsächlich sind. Die genannten Individuen schreiben ihren Erfolg maßgeblich nicht sich selbst sondern externen Faktoren zu und zweifeln folglich auch an ihren Fähigkeiten und ihrer Intelligenz. Doch könnte es sein, dass sie (zu einem gewissen Grad) gar nicht falsch liegen und lediglich Erfolgsfaktoren in Betracht ziehen, die manch andere (un)bewusst verschweigen? Sollten wir nicht stattdessen die Idee der „self-made-Kultur“, nach der alle ihre Erfolg einfach nur sich selbst zuschreiben, hinterfragen? Selbstverständlich spielen externe Umstände eine Rolle in unserer individuellen Erfolgsgeschichte und es wäre genauso problematisch, diese Faktoren, wie zum Beispiel einen glücklichen Zufall oder, noch entscheidender, sozio-strukturelle Gegebenheiten, auszublenden.
Aber auch wenn wir uns auf die individuellen Fähigkeiten als wesentlichen Erfolgsfaktor beschränken, ist der alleinige Fokus auf Talent falsch und vor allem schädlich. Menschen (und davon berichten tatsächlich mehrheitlich Frauen), die sich als intellektuelle Betrüger*innen sehen, reden oft davon, dass sie sich für ihren Erfolg anstrengen mussten. Dabei wird Anstrengung als negativ und als das genaue Gegenteil von Talent bzw. Intelligenz betrachtet. Intelligenz wird als fest und angeboren verstanden und lässt sich somit auch durch Anstrengung nicht maßgeblich beeinflussen. In Kulturen, in denen solch ein Verständnis von Intelligenz vorherrscht, wird Anstrengung vor anderen oft verheimlicht, da für den „einzig wahren Erfolg“ Talent benötigt wird. So kann eine Person Selbstzweifel entwickeln, da Anstrengung an sich schon Beweis genug ist, dass sie sich den Erfolg nicht verdient hat. Sie könnte weiterhin meinen, nicht zur Gruppe zu gehören, da alle anderen keine Zeichen von Anstrengung zeigen. Dies ist auch aus der Geschlechterperspektive ein wichtiger Aspekt, insofern Frauen in männerdominierten Berufen (oder die, die sich für eines interessieren) glauben können, das vermeintlich „natürliche“ Talent nicht zu besitzen.
Ein Versuch, Menschen hemmende Selbstzweifel abzunehmen, kann sein, eine Kultur bzw. Umgebung zu schaffen, in der ein offener und ehrlicher Diskurs stattfindet: Über die Vielzahl externer Faktoren, die unseren Erfolg beeinflusst haben, wie auch über den Aufwand und letzten Endes auch über Misserfolge, die wir bewältigen mussten.
Literatur
P. R. Clance, S. A. Imes (1978): The impostor phenomenon in high-achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. In: Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15:241–47. Text bei Semantic Scholar. Zuletzt abgerufen am 26.08.2020.
Katherine Hawley (2019): I—What Is Impostor Syndrome? In: Aristotelian Society Supplementary Volume, 93(1):203–226, Text bei Oxford Academic. Zuletzt abgerufen am 26.08.2020.
Slank, Shanna (2019): Rethinking the Imposter Phenomenon. Ethical Theory and Moral Practice, 22:205–218, Text auf Springer Link. Zuletzt abgerufen am 26.08.2020.
von Anja Goetz
Gespräch in einem Sitzungstermin: Wie können wir alle „Mitarbeiter“ mitnehmen? Oder „die Sprechstunde für Studenten findet heute nicht statt“. Wer viel liest und aufmerksam zuhört, stellt schnell fest: Das generische Maskulin erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Denn trotz hochschulpolitischer Instrumente wie Satzungen oder Richtlinien – in denen geschlechtergerechte Sprache als verpflichtender Bestandteil aller Texte und in der mündlichen Sprechweise gefordert wird – sind Menschen, die nicht männlich sind, sprachlich selten sichtbar. Daher hier ein paar Überlegungen zu einem Thema, das die Gemüter immer und immer wieder zum Kochen bringt.
Sprache ist die Grundlage jeder gesellschaftlichen Interaktion. Egal ob ich programmiere, Netflix schaue, Vorträge halte, lese oder einen Kaffee bestelle. Ohne Sprache käme ich nicht besonders weit. Daher liegt es auch nicht fern, anzuerkennen, wie wichtig Sprache ist und wie sehr sie unser gesellschaftliches Zusammenleben bestimmt. Was bedeutet also geschlechtergerechtes Sprechen? Der Maßstab bei einer geschlechtergerechten (und diskriminierungsfreien Sprache) ist eine gleichwertige Ansprache. Es gibt zahlreiche empirische Befunde die zeigen, dass geschlechtergerechte Sprachformen positive Auswirkungen auf die tatsächliche Geschlechtergerechtigkeit haben. Wenn beispielsweise behauptet wird, mit der Formulierung „Mitarbeiter“ alle Geschlechter zu meinen, so ist wissenschaftlich belegt, dass das bei den nicht Genannten als aus- und nicht einschließend wahrgenommen wird. Und mal ganz ehrlich, ein bisschen Trägheit ist da auch schon dabei, oder? Das ist übrigens auch eine Tatsache: Menschen sind relativ träge und reagieren auf Wandel eher abwehrend. Daher gibt es auch schon etablierte Abwehrmuster gegen geschlechtergerechte Sprache: Da wäre zum Beispiel das Slippery Slope-Argument. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass geschlechtergerechte Sprache von oben herab diktiert würde. Folge daraus wäre, dass die Entscheidungsmacht über Sprache in die falschen Hände gerät und dann nicht mehr zu steuern sei. Tatsächlich kommen die Forderungen nach einer geschlechtergerechten Sprache aber von den Menschen, die bislang nicht angesprochen oder nicht gehört wurden. Ein Blick auf machtvolle Positionen in unserer Gesellschaft zeigt, dass diese Menschen in Führungsebenen, Vorstände, Berufen mit Einfluss nicht unbedingt zahlreich vertreten sind. Die völlig berechtigte Forderung nach sprachlicher Repräsentanz, Gleichstellung und Sichtbarkeit kommt also gerade nicht von „oben“.
Aber zurück zum Thema Sprache: Zugegebenermaßen ist es im Deutschen etwas herausfordernder geschlechtergerecht zu sprechen, als zum Beispiel im Finnischen. Im Finnischen kann man problemlos stundenlang über eine Person sprechen, ohne deren Geschlecht auch nur einmal benennen zu müssen. Aber auch im Deutschen ist das generische Maskulin keine grammatische Norm, an die sich alle halten müssen. Es ist auch nicht geschlechtsneutral, wie viele vermuten. Es versprachlicht eben nur den Teil der Gesellschaft, der die Beschreibung Mann oder männlich für sich nutzt. Und so kompliziert ist es auch nicht. Wenn wir zum Beispiel inklusiv sprechen und auch nicht-binäre Menschen (also Menschen die sich weder in einer männlichen oder weiblichen Geschlechtsidentität verorten) mitmeinen, können wir Student*innen schreiben und sprechen. Beim Sprechen macht man dann eine kleine Pause, an der Stelle, an der das Sternchen steht, wie wenn man ganz deutlich „ver-reisen oder ver-eisen“ sagt.
Ein Zitat des Philosophen Ludwig Wittgenstein bringt es auf den Punkt: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Dieser Longread basiert auf der Tagung „Denken – Sprechen – Gendern“, die am 10. und 11.10.2019 in Hannover stattfand.
von Anja Goetz
Ist man im Bereich Gleichstellung und Diversität aktiv, begegnen einem ab und an Fragen, ob das konkrete Frauenförderprojekt auch für Männer sei, ob Promotionsberatung für Studentinnen auch für Studenten sei und und und… Solche Fragen sind bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Und zwar bis dahin, wo sie verneint werden und der*die Nachfragende sich mit einem freundlichen „Danke für die Informationen. Ich wünsche noch einen schönen Tag“ verabschiedet. Wagemutig behaupte ich, dass das eher die Minderheit ist. Regelmäßiger folgt eine Diskussion zu „Männer hätten auch einen Förderbedarf“ und „jetzt seien doch auch mal die Jungs dran“.
Es lässt sich nicht verneinen, dass einzelne Männer und Jungs auch unter Benachteiligung zu leiden haben, aber eben nicht strukturell. Praktische Gleichstellungsarbeit und damit Förderprogramme für Frauen basieren auf umfangreichen Studien die zeigen, dass Frauen beim beruflichen Aufstieg, bei den Verdienstmöglichkeiten und in vielen weiteren Bereichen schlechtere Chancen haben als Männer, z.B. um als Professorin an einer (technischen) Hochschule zu arbeiten. Mit konkreten Projekten soll dieser strukturellen Benachteiligung entgegengewirkt werden, um step by step mehr Frauen in diese Positionen zu bringen. Die meisten Vornamen von Menschen mit Professur in Deutschland sind heute übrigens Hans, Klaus und Peter. Die Häufung eines weiblichen Vornamens bei Menschen mit Professur findet sich mit Susanne erst auf Platz 62.[1]
Das ist auch schon im deutschen Antidiskriminierungsrecht angekommen. Unter dem Stichwort „gerechtfertigte Ungleichbehandlung“ werden Maßnahmen gefasst, die marginalisierte Gruppen unterstützen und nicht-marginalisierte Gruppen eben nicht unterstützen. Ziel ist dabei, eine ungleiche Ausgangslage auszugleichen.
Behauptungen einer strukturellen Benachteiligung von Männern mischen sich aber schon länger in geschlechterpolitische Diskussionen. Ein immer wiederkehrendes Motiv dabei ist, dass Männer die neue diskriminierte Gruppe seien, die Benachteiligung aber nicht anerkannt wird. Bedient wird sich dabei gern am Narrativ des Opfers (vgl. Rosenbrock 2012: 68ff.). Strategisch bietet das zwei „Vorteile“. Erstens kann ein einfaches Feindbild konstruiert werden (zum Beispiel Frauenförderung oder noch verbreiteter: Feminismus). Zweitens bietet das Narrativ des Opfers eine moralische und oberflächliche Anschlussfähigkeit, denn wenn Männer benachteiligt sind, muss eingegriffen werden, genau wie bei den Frauen (ebd.). Aber Männer als Opfer der Strukturen zu konstruieren, die Frauen stark machen sollen, führt – wenn man es ernst meint mit der Gleichberechtigung – nicht zum Ziel (ebd.). Denn Männer sind nicht Opfer der Frauenförderung, sondern ebenfalls Opfer des Patriarchats (wenn auch nicht alle Männer). Auch Männer unterliegen stereotypen Vorstellungen, die nicht dadurch verändert werden, auch Männer zu fördern. Unter dem Stichwort toxische (schädliche) Männlichkeit werden ebenjene Männlichkeitskonzepte verstanden, die es nicht z.B. erlauben, schwach und liebevoll zu sein oder in eine Decke gekuschelt mit dem besten Freund GZSZ zu gucken. Daher könnte das Opfer-Narrativ sogar eine Diskussion in Gang bringen, die hilft, Männlichkeit zu überdenken. Und das führt nicht zu Förderprogrammen, sondern dazu, wer bisher ungerechtfertigt bevorteilt wurde. Und davon profitieren auch Männer.
Literatur
Rosenbrock, Hinrich (2012): Die Hauptideologien der Männerrechtsbewegung: Antifeminismus und männliche Opferideologie. In: Kemper, Andreas (Hg.). Die Maskulisten. Organisierter Antifeminismus im deutschsprachigen Raum. Münster: Unrast. 58-78.
[1] Dies ergab eine Auswertung des „Hochschullehrerverzeichnis 2018“. Zuletzt abgerufen 26.08.2020)
von Anja Goetz
Diversity gewinnt in akademischen Kontexten immer mehr an Bedeutung. Das ist insofern gut, dass nicht länger der weiße, cis- und Heterostudent ohne Behinderung zwischen 18 und 45 als Prototyp des Studenten, Professors, Mitarbeiters verstanden wird. Dennoch ist zu erkennen, dass nicht einfach „Diversity an Hochschulen gemacht werden kann“ oder gefragt werden kann, „wie mit Diversity umzugehen ist“. Ein Grund dafür liegt in den verschiedensten Ausprägungen des Diversity-Begriffs in Form von Diversity Management, Managing Diversity, Diversity Mainstreaming und weiteren.
Teils basieren diese Varianten von Diversity auf dem ökonomischen Gedanken eine möglichst hohe Produktivität erzielen zu wollen. In Bezug auf Diversity-Management kann dies beispielsweise bedeuten, dass heterogene Teams im Vergleich zu homogenen Teams bessere und nachhaltigere Ergebnisse liefern. Per se ist diese Herangehensweise nicht ganz und gar zu verurteilen, denn tatsächlich blieben bis zum Aufkommen von Diversity sicher viele Potenziale ungenutzt. Es ist allerdings ein Fehler, diese Logik eins zu eins auf Diversity an Hochschulen zu übertragen. Es reicht also nicht, die Vielfalt der Studierenden in Hochglanzbroschüren zu feiern.
Für Hochschulen sollte Diversity daher auch bedeuten, Räume der Kritik zu eröffnen. Das kann sich darin zeigen, dass sich eine Hochschule dem Thema Antidiskriminierung verpflichtet. Ist dies der Fall, gesteht sie damit auch ein, dass diskriminiert wird. Das mag banal klingen, ist aber ein wichtiger Schritt.
Meist liegt der Fokus beim Thema Diversity auf den Studierenden. Das ist insofern nicht verwunderlich, da sie den größten sichtbaren Personenanteil an Hochschulen abbilden. Solange sich diese Vielfalt aber nicht auch auf den entscheidungsfällenden Positionen in Lehre, Führung und Verwaltung widerspiegeln (zahlenmäßige Gleichstellung ist by the way nur ein Ziel von vielen), muss man sich der innerorganisatorischen diskriminierenden Logik stellen. Dies kann über eine gut integrierte und besonders institutionalisierte Antidiskriminierungsarbeit geschehen und darüber, dass alle Hochschulangehörigen sich als Teil dieser Arbeit verstehen. Das wäre ein weiterer wichtiger Schritt, denn: Sich nicht mit Diversity (Antidiskriminierung) beschäftigen zu müssen oder zu wollen ist ein Zeichen von Privilegien. Notwendig ist es daher ein Bewusstsein für das eigene Privilegiert-Sein zu entwickeln und gezielt zu fragen „Warum denke ich, dass dieses oder jenes für mich nicht interessant ist“ oder „Warum fühle ich mich nicht angesprochen“. Der Begriff des Privilegs – wie er heute verstanden wird – bedeutet, bestimmte Sonderrechte zu haben, die andere Menschen nicht einfach so haben. Anders formuliert: die unverdiente Freiheit zu besitzen, sich keine Gedanken zum Beispiel über Rassismen, Sexismen, Klassismen, Ableismen machen zu müssen oder frei entscheiden zu können, ob sich diese Gedanken mit allen Konsequenzen gemacht werden. Für Akteur*innen der praktischen Antidiskriminierungsarbeit kann sich das Konzept „ask the other question“ nach Maria Matsuda anschließen (vgl. 1991: 1189): Wenn ich eine Situation sehe, die ich als rassistisch definiere, frage ich „Wo ist der Sexismus darin?“. Oder wenn ich etwas Homofeindliches beobachte, frage ich „Wo stecken die Klasseninteressen darin?“. Dies erscheint mir als nützliches Werkzeug, einem selbstreflexiven Antidiskriminierungsanspruch an Diversity näher zu kommen. Insofern ist die Eigenkritik als Form der Frage an sich selbst, ein wichtiger Schritt für Hochschulangehörige (ob nun in der Antidiskriminierungsarbeit institutionalisiert oder nicht), sich der innerorganisatorischen Diskriminierungslogik zu stellen und damit „Diversity an Hochschulen zu machen“.
Quelle
Matsuda, Maria J. (1991): Beside My Sister, Facing the Enemy: Legal Theory out of Coalition. In: Stanford Law Review 43 (6): 1183–92. (PAYWALL).
von Anja Goetz
Kalte, nicht-organische Materie, Algorithmen, Kunststoffe und hochmodernisierte Verfahren. Technik gilt als neutraler Bereich. Das Synonym einer schnelllebigen Zeit, ganz nach dem Motto „was ich heute kaufe, ist morgen schon Elektroschrott“. So sollen beispielsweise Computer bis 2040 in der Lage sein, eine Datenrate von etwa 100 Billionen Bits pro Sekunde zu verarbeiten. Im Jahr 2008 waren es noch etwa 10 Milliarden Bits in der Sekunde. Und Technik gilt nicht nur als neutral, sie gilt auch als geschlechtsneutral. Denn eine geschlechtliche Einordnung läuft in westlichen Gesellschaften nach wie vor über einen organisch-fleischlichen Körper.
Können wir also die Sektgläser füllen? Lässt sich die körperfixierte Geschlechtlichkeit mittels technischer Innovationen überwinden? Sind Roboter, Avatare und Künstliche Intelligenzen der nächste Schritt in eine chancengleiche Welt? Eine Welt in der Geschlecht an Bedeutung verliert? Verbunden damit die Hoffnung, dass sich dominante Machtstrukturen auch gleich mal mitüberwinden lassen.
Weit gefehlt! Technische Innovationen, allen voran die K.I.-Forschung, sind durchtränkt von Vorstellungen über und Erwartungen an Geschlecht. Die in Deutschland wohl bekanntesten K.I.´s heißen Siri und Alexa. Ständig verfügbar, immer freundlich, niemals fordernd. Als serviceorientierte Dienstbarkeiten lesen sie uns jeden Wunsch von den Lippen. Das alles sind vergeschlechtlichte Charakteristika, die Karin Hausen schon 1976 als angelernte Rollenmuster enttarnte. Soviel zum Modernisierungsaspekt der Technik.
Aber auch die Technik-Nutzer*innen schaffen es nicht aus diesem Korsett auszubrechen: Jenseits von realweltlich zugewiesenem Geschlecht könnten wir als User*innen im virtuellen Raum nach Belieben alle möglichen Identitäten annehmen und ganz frei neue Körper erschaffen. Wir tun es aber nicht: Denn obwohl der Fantasie dank Technologie keinerlei Grenzen gesetzt werden, wird sogar verstärkt auf traditionelle Geschlechtercodes einer Frau-Mann-Dyade zurückgegriffen, als dass wir die Überwindung veralteter Geschlechterkonzepte feiern könnten.
Ebenso hinderlich ist die Gruppe der Entwickler*innen von Technik. Denn das Gleichberechtigungs-Potenzial eines technischen Produktes steht und fällt mit dem sozialen Erfahrungsraum der*des Macher*in. Fakt ist, dass bisher immer noch fast ausschließlich Männer* in der Tech-Industrie arbeiten. Die Szene ist getränkt durch den von Laura Mulvey geprägten Begriff des männlichen Blicks. Dass das Bild eines nackten Frauenkörpers zum ersten Referenzbild algorithmischer Bilderkennung auserkoren wurde, lag übrigens daran, dass ganz zufällig ein Playboy herumlag. Aber das war ja 1973, höre ich einige kritische Stimmen rufen. All jenen möchte ich eine Leseempfehlung geben: Ein kürzlich erschienenes Buch von Emily Chang, amerikanische Journalistin des Bloomberg Technology TV, gibt Einblicke in Geschichte und Gegenwart des Silicon Valley.
Der Titel des Buches lautet „Brotopia“. Ein Wortspiel aus dem Amerikanischen „Bro“ für frauenausschließende Männerbündnisse und „utopia“ als Synonym für paradiesische Verhältnisse.
Literatur
Bath, Corinna (2003): Einschreibungen von Geschlecht: Lassen sich Informationstechnologien feministisch gestalten? In: Weber, Jutta/Bath, Corinna: Turbulente Körper, soziale Maschinen. Feministische Studien zur Technowissenschaftskultur, Opladen: Leske + Budrich, 75-98
Funken, Christiane (2000): Körpertext oder Textkörper – Zur vermeintlichen Neutralisierung geschlechtlicher Körperinszenierungen im elektronischen Netz. In: Becker, Barbara/Schneider, Irmela (Hrsg.): Was vom Körper übrig bleibt. Körperlichkeit – Identität – Medien, Frankfurt/Main: Campus, 103-130
Schriftenreihe des Gender- und Technik-Zentrums (GuTZ)
Herausgeberinnen: Prof. Dr. Eva-Maria Dombrowski (Fachbereich VIII) und Prof. Dr. Antje Ducki (Fachbereich I)
Seit Gründung des Gender- und Technik-Zentrums 2009 erscheint die Schriftenreihe jährlich als Open Access im Verlag Barbara Budrich. Hier können Sie alle Ausgaben als PDF herunterladen.
Schriftenreihe Band 12
Technische Hochschulen: Attraktive Arbeitsorte für Frauen und Männer? Der Weg von technischen Hochschulen zu geschlechtergerechten Organisationen
Antje Ducki, Randi Worath, Hedda Ofoole Knoll, Lena Ziesmann; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 12/2020
Download PDF (1 MB)
Schriftenreihe Band 11
Gender Diversity in der Tech-Branche: Warum Frauen* nach wie vor unterrepräsentiert sind
Franziska Beckert; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 11/2020
Download PDF (1,8 MB)
Schriftenreihe Band 10
Design Thinking, Digitalisierung und Diversity Management: Ein Praxisleitfaden für die Lehre
Katharina Gläsener, Thomas Afflerbach, Antje Ducki; Schriftenreihe des GuTZ, Ausgabe 10/2019
Download PDF (1,7 MB)
Schriftenreihe Band 9
Karrierewege zur Professur an einer Fachhochschule
Ulla Diallo-Ruschhaupt, Susanne Plaumann, Eva-Maria Dombrowski; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 9/2018
Download PDF (4,5 MB)
Schriftenreihe Band 8
Gendersensible Gestaltung des neuen Studiengangs „BWL – Digitale Wirtschaft“ an der Beuth Hochschule für Technik Berlin
Martina Brandt, Antje Ducki; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 8/2017
Download PDF (644 KB)
Schriftenreihe Band 7
Studentische Essays zum Thema Internet und die Gesellschaft
Ilona Buchem; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 7/2014
Download PDF (958 KB)
Schriftenreihe Band 6
Studentinnen mit Migrationshintergrund in Chancengleichheitsprojekten - Eine Annäherung
Christiane Erlemann; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 6/2013
Download PDF (4,3 MB)
Schriftenreihe Band 5
Gender Toolbox
Susanne Ihsen, Antje Ducki; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 5/2012
Download PDF (1,1 MB)
Schriftenreihe Band 4
Diverse Teams = Erfolgsteams? Bedingungen für die Interaktion in geschlechts - und nationalitätsgemischten Teams.
Katharina Gläsener; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 4/2011
Download PDF (219 KB)
Schriftenreihe Band 3
Die Vielfalt gestalten - Diversity an Hochschulen.
Stefanie Ehmsen; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 3/2010
Download PDF (195 KB)
Schriftenreihe Band 2
„Studieren in der Lounge“ - Wie StudentInnen Ihre Hochschule gestalten würden. Eine geschlechterdifferenzierende Exploration.
Annette Pattloch; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 2/2010
Download PDF (218 KB)
Schriftenreihe Band 1
Wer wagt, gewinnt? Geschlechtsspezifische Unterschiede im Entscheidungsverhalten unter Risiko.
Karoline Barthel; Schriftenreihe GuTZ, Ausgabe 1/2009